Die Bedeutung der ungarischen Minderheit
Eine vergleichsweise isolierte, aber dennoch aktive Rolle spielte die Bewegung der ungarischen Minderheit in der Slowakei, die vor allem zur liberalen Opposition in Ungarn Verbindungen unterhielt. Zu Kontakten mit der intellektuellen Opposition in der Slowakei kam es recht selten und relativ spät, diese erfolgten besonders über Kontakte zu Personen aus dem Umfeld der Charta 77. Politisches Sprachrohr der ungarischen Minderheit war das „Komitee zur Verteidigung der ungarischen Minderheitenrechte in der Tschechoslowakei“, dessen Gründer László Nagy, Miklós Duray und Péter Püspöki-Nagy schon in den 60er Jahren im ungarischen Studentenclub „Atilla József“ aktiv gewesen waren. Der Auslöser für die Entstehung des Komitees geht auf ein Ereignis aus dem Jahr 1978 zurück, als es zu Protesten der ungarischen Intelligenz im Süden der Slowakei gegen eine Regierungsentscheidung kam, in Schulen mit ungarischem Unterricht den Anteil der slowakischen Unterrichtssprache auszuweiten. In der Lesart der slowakischen Ungarn war dies ein Ausdruck nationaler Diskriminierung und stellte den Versuch dar, sie zur Assimilation zu drängen. Letztlich trug die Gründung des Komitees mit zur Rücknahme dieser Entscheidung bei. Dadurch, dass die ungarische Minderheit ihre programmatischen Texte einer größeren Öffentlichkeit auch über die Bürgerrechtsbewegung Charta 77 zugänglich machte, erlangte sie in der ganzen Tschechoslowakei und im Ausland Bekanntheit.
Das Komitee war in seiner Arbeit dem kommunistischen Regime gegenüber sehr kritisch eingestellt. Alle Dokumente wie etwa über die tschechoslowakische Minderheitenpolitik und die Lage der Menschenrechte im Land wurden direkt an die Kommunistische Partei geschickt und parallel im Ausland verbreitet. Sie wurden nur von Miklós Duray unterschrieben, der auf diese Weise jede Verantwortung auf sich nahm.
Ende 1983 befassten sich die slowakischen Partei- und Regierungsinstitutionen erneut mit Plänen zur Reorganisation des Minderheitenschulwesens, insbesondere mit dem der slowakischen Ungarn. Am 10. Mai 1984 wurde Miklós Duray in Bratislava verhaftet und acht seiner Mitarbeiter verhört. Angeklagt wurde er wegen angeblicher „Beleidigung der Nation, der Rasse und anderer Ansichten“. Ein Jahr später wurde er aufgrund einer allgemeinen Amnestie aus der Haft entlassen. Viele tschechische und slowakische Dissidenten sowie slowakische Emigranten traten damals öffentlich für ihn ein. Auch wenn sie sich nicht der Meinung Durays zur Situation der Minderheit und des Schulwesens in der Slowakei anschlossen, protestierten sie doch gegen seine Verhaftung aufgrund staatskritischer Äußerungen.
Ab 1986 vertieften sich die Kontakte zwischen den ungarischen und slowakischen Bürgerrechtlern mit denjenigen aus dem Umfeld der Charta 77. Die Gespräche betrafen vor allem die Erarbeitung eines gemeinsamen Dokuments zur ungarischen Minderheit. Allerdings konnten sich beide Seiten hierzu nicht verständigen. Trotzdem gaben die Vertreter des Komitees und der Charta 77 1987 gemeinsam eine Erklärung ab, in der sie auf die Minderheitenrechte in internationalen Abkommen verwiesen. Auslöser hierfür waren zunehmende Angriffe „unbekannter Täter“ auf Einrichtungen der ungarischen Minderheit in Bratislava.
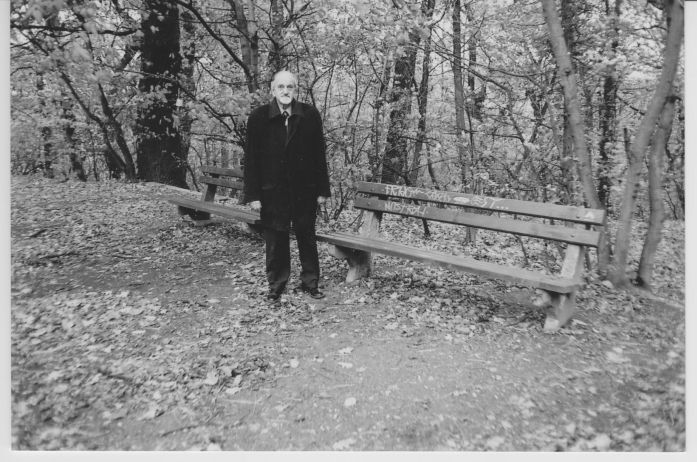
Der slowakische Historiker Ivan Laluha (geboren 1932) war während des Prager Frühlings Anhänger der Reformkommunisten um Alexander Dubček, dessen Ideen er auch in späteren Oppositionsgruppierungen treu blieb. 1988/89 gab er die Untergrundpublikation „Myšlienka a čin“ mit heraus. Nach der Samtenen Revolution zog Laluha für Öffentlichkeit gegen Gewalt und anschließend für die Bewegung für eine Demokratische Slowakei in das tschechoslowakische bzw. slowakische Parlament ein.
Die kontroversen Anschauungen Miklós Durays trugen mit dazu bei, dass eine geplante Studie zu den slowakisch-ungarischen Beziehungen und zur Situation der ungarischen Minderheit in der Slowakei nicht verfasst werden konnte. Als Autoren waren Miklós Duray, Milan Šimečka, Miroslav Kusý und Ján Čarnogurský vorgesehen. Eigentlich planten sie, die Studie in einem Konferenzband der Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft im September 1986 in Boston zu veröffentlichen. Da sich die Autoren nicht auf den gemeinsamen Wortlaut ihrer Veröffentlichung einigen konnten, erschienen in dem Band stattdessen unterschiedliche Fassungen einzelner Autoren. Auch gelang es ihnen nicht, einen neuen Entwurf für die tschechoslowakische Verfassung als Alternative zur offiziell gültigen auszuarbeiten, obwohl slowakische und ungarische Dissidenten 1988/89 dazu Gespräche geführt hatten. Auch wollte sich die Charta 77 nicht ohne Zustimmung der slowakischen Opposition mit den Problemen der ungarischen Minderheit im Süden des slowakischen Landesteils befassen. Gleiches galt für Fragen um den Bau des Staudamms von Gabčikovo-Nagymaros an der Donau. Dieser wurde schließlich zum zwischenstaatlichen Konflikt zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn.
Mit dem ungarischen Komitee arbeitete auch eine Gruppe junger liberaler Bürgerrechtler zusammen, denen die Frage der Menschenrechte in ihrer ganzen Bandbreite wichtig war. Um 1980 herum knüpften Bürgerrechtler der ungarischen Minderheit in der Slowakei Kontakte zu Vertretern der liberalen Opposition in Ungarn. Sie schleusten Untergrundliteratur aus Ungarn in die Slowakei ein oder besuchten die Seminare der Fliegenden Universität in Budapest. Auf Initiative Károl Tóths und László Öllős‘ wurden im Rahmen dieser privaten und halböffentlichen Seminaren spezielle Kurse für Studenten der ungarischen Minderheit aus der Slowakei angeboten. Während der ersten Haftstrafe Miklós Durays 1982-83 legte das „Komitee zur Verteidigung der ungarischen Minderheitenrechte in der Tschechoslowakei“ offiziell seine Arbeit nieder. Tatsächlich wurde seine Tätigkeit aber unter dem Deckmantel des Komitees zur Verteidigung der ungarischen Schulen weiter geführt. Hier engagierten sich neben Károl Tóth und László Öllős auch Tibor Kovács, Elonora Sándor, Zsuzsanna Németh und Mária Bodnár. Nach der Entlassung Miklós Durays aus dem Gefängnis nahm das Komitee seinen ursprünglichen Namen wieder an.
