Die unabhängige Kultur
Zur gleichen Zeit wuchs landesweit, aber vor allem in Bratislava (Pressburg), eine unabhängige Kultur heran. Eine Gruppe unabhängiger bildender Künstler, die unter dem Einfluss der europäischen Avantgardekunst standen wie beispielsweise Alex Mlynárčik, Stanislav Filko und Rudolf Sikora setzte ihre in den 60er Jahren begonnene Tätigkeit fort. Viele von ihnen hatten keine Möglichkeit, ihre eigenen Arbeiten auszustellen, weshalb sie diese auf eigene Faust vervielfältigten und gemeinsame Bildbände herausgaben.
Anfang der 70er Jahre schlossen sich ihnen junge Künstler und Intellektuelle der Gruppe „DG“ (Degenierte Generation/Degenerovaná generácia) an, die unter anderem von Ján Langoš, Oleg Pastier, Martin M. Šimečka, Ján Budaj, Gabriel Levický, Tomáš Petřivý, Jiří Olič und Vladimír Archleb gegründet worden war. Sie lehnten kategorisch jeden Kompromiss mit der kommunistischen Regierung ab und versuchten erst gar nicht, in staatlich kontrollierten Strukturen zu wirken oder in offiziell zugelassenen Zeitschriften zu veröffentlichen. Die DG-Mitglieder bestanden aus Schriftstellern, bildenden und Performance-Künstlern, während sie im Alltag Heizer, Reinigungskräfte oder Lagerarbeiter waren. Einige von ihnen wie Ján Budaj und Tomáš Petřivý wurden aus politischen Gründen von der Hochschule relegiert, andere verließen diese aus freien Stücken. Zusammen mit Amateurtheatern veranstalteten sie Straßenaktionen und Konzerte verbotener Künstler des tschechischen Vereins „Šafrán“ (Safran) und organisierten illegale Ausstellungen und Seminare der Fliegenden Universität, die 1977 und 1978 in Bratislava stattfanden. Verfolgte Politiker und Intellektuelle wie etwa Miroslav Kusý, Milan Šimečka, Tomáš Štrauss und Jan Šimsa aus Brünn hielten hier Vorträge. Die Intervention der Staatssicherheit setzte der Fliegenden Universität jedoch bald ein Ende.
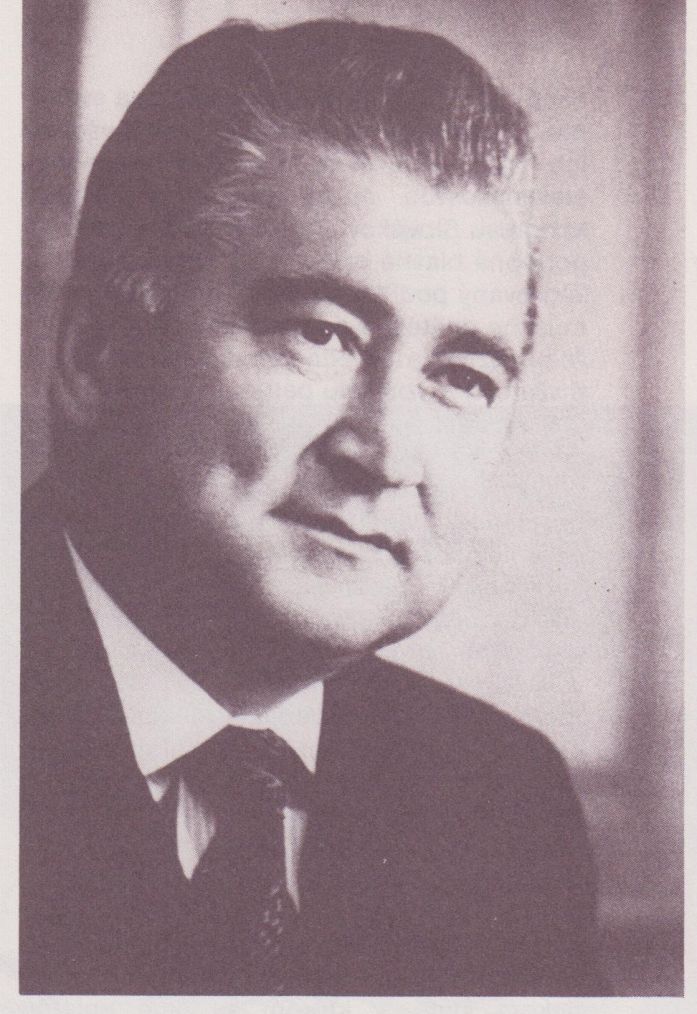
Štefan Boleslav Roman (1921–88), langjähriger Vorsitzender des Slowakischen Weltkongresses in Toronto, einer der wichtigsten Institutionen des slowakischen politischen Exils
Zwar hatten diese künstlerischen Aktionen keinen explizit politischen Charakter, sie trugen aber durch ihre große Popularität besonders unter Jugendlichen und durch das Fehlen einer gesellschaftlichen Opposition, welche sich erst später bildete, jedoch entscheidend zur Entwicklung einer vom Staat unabhängigen Kultur bei.
Eine wichtige Rolle spielten die Untergrundverlage. Der erste slowakische Autor, der seine Bücher im Samisdat veröffentlichte, war Ivan Kadlečík. Im Prager Verlag Edice Petlice gab er 1973 „Sprachen aus dem Tiefland“ (Reči z nížiny) heraus und 1974 „Gesichter und Anrede“ (Tváre a oslovenia). Marcel Strýko und der Dichter Erik Groch verlegten in Košice zwischen 1978 und 1980 die Zeitschrift „Trinásta komnata“ (Das dreizehnte Zimmer). In Bratislava wurde 1981 die erste nicht religiöse Untergrundzeitschrift „Kontakt“ gedruckt. Ihr folgten etwas später die Zeitschriften „Altamira“, „Fragment“ und „K“. Als sich die gesellschaftliche Stimmung im Land insbesondere unter den von der polnischen Solidarność beeinflussten Intellektuellen änderte, beeinflusste dies auch die Entwicklung oppositioneller Initiativen dieser Zeit.
Weitere Gruppen, die sich nicht primär als politische Opposition definierten, fanden sich in der Ökologiebewegung wieder, in der Mikulás Huba und Ján Budaj die führende Rolle innehatten. Budaj organisierte die Veranstaltung „Drei sonnige Tage“ (Tri slnečné dni, 3SD), die Werke verbotener Künstler, Ökologen und Kunsthistoriker aus Bratislava, Prag, Brünn und Warschau zeigte und zum gegenseitigen Kennenlernen beitrug. Auch die ein Jahr später erfolgreich durchgeführte Aktion zur Rettung alter Pressburger Friedhöfe fand ein großes gesellschaftliches Echo. Das Stadtkomitee Bratislavas der Kommunistischen Partei hatte die Absicht, die Mehrheit der Grabplatten auf alten Friedhöfen abräumen zu lassen. Zwar gelang es den Aktivisten, dies zu verhindern, doch verbot die Kommunistische Partei im Gegenzug die Vereinszeitschrift „Ochranca prírody“ (Umweltschützer), die vom Slowakischen Naturschutzbund herausgegeben wurde. Als Verbandszeitschrift war sie nur zum internen Gebrauch vorgesehen und hätte daher einer weniger strengen Zensur unterliegen müssen.
Die bürgerliche Opposition
Einen explizit politischen Charakter hatte die verhältnismäßig kleine Gruppe von Intellektuellen aus dem Umfeld der nach 1969 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossenen Mitglieder. Inhaltlich fanden sie sich auf der Grenze zwischen demokratischem Sozialismus und Liberalismus wieder. Aus ihren Reihen kamen die slowakischen Unterzeichner der Charta 77 wie Miroslav Kusý, Dominik Tatarka, Ján Mlynárik, Vladimír Čech und Hana Ponická. Obwohl sie nur ein schwaches Echo in der slowakischen Gesellschaft auslösten, trug sie doch zur Entwicklung einer bürgerlichen Opposition bei und ermöglichte dieser nicht zuletzt Kontakte ins Ausland. Mit der bürgerlichen Opposition verknüpft waren Intellektuelle wie Július Strinka, Milan Šimečka und Jozef Jablonický, die mit den Ideen der Charta 77 sympathisierten, auch wenn sie die Petition nicht unterschrieben hatten, sowie Schriftsteller wie Ivan Kadlečik, Albert Marenčin und Pavel Hrúz, die zwar eher unpolitisch waren, jedoch im Samisdat oder im Ausland veröffentlicht hatten. Diese kleine, aber intellektuell einflussreiche Gruppe publizierte ab 1978 ihre Arbeiten in Untergrundverlagen zunächst in Prag, später auch in der Slowakei oder im Ausland.
Auch die Mitglieder der bürgerlichen Opposition sahen sich Repressionen ausgesetzt, ihnen blieben aber zumindest bis 1981 jahrelange Haftstrafen und politische Prozesse erspart. Zu umfassenderen Angriffen des Regimes gegen diese Gruppen kam es erst nach dem Vorfall mit einem französischen Lastwagen, der an der Grenze zur Bundesrepublik voll beladen mit Samisdatliteratur aufgegriffen wurde. Bei dieser Gelegenheit fanden die Behörden auch eine Adressliste der Empfänger. Wegen des angeblichen „Versuchs, die Republik zu stürzen“ wurden Milan Šimečka, Miroslav Kusý und Jozef Jablonický angeklagt, insgesamt kamen 30 Personen in Haft. Auf internationalen Druck hin wurden bis Mai 1982 alle Inhaftierten wieder freigelassen und es kam zu keinem Gerichtsprozess. Trotz dieses Erfolgs trugen sowohl die Verhaftungen als auch das 1981 in Polen ausgerufene Kriegsrecht zu einer Atmosphäre von Resignation und gesellschaftlicher Apathie bei. Gleichzeitig wurden die staatlichen Repressionen weiter verschärft.
